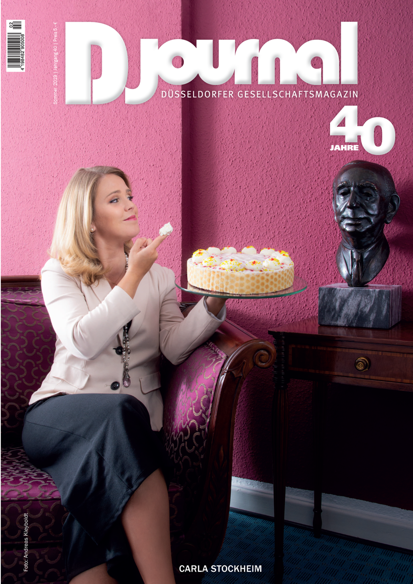„Konichiwa“
Reisebericht Japan
von Caroline Merz
Um dieses Land und seine Menschen wirklich zu verstehen, muss man mehrfach hingereist sein. Ein Land voller Gegensätze: Einsamkeit und Menschenmengen, moderne Technologie bis zum Abwinken und der Glaube an Jahrhunderte alte Traditionen gepaart mit menschlichen Nöten und Kälte; und doch findet man sie, die offen und schon fast kindlich netten Japaner. Trotzdem, die Japaner bleiben am liebsten unter sich. Für uns Rheinländer oft total verschlossen.
Zum Beispiel Ausgehen in Japan: Geisha oder Hostessen Bars kann man als Ausländer nie besuchen, höchstens, wenn man von einer Gruppe männlicher Japaner mitgenommen wird. Diese Bars gibt‘s übrigens auch für Frauen - dort bekommt man keinen Sex, aber viele Komplimente. Die bekommt eine japanische Frau sozusagen nie von ihrem Mann, daher sind sie sehr beliebt und unfassbar teuer - eine Komplimentestunde kostet circa 350 €, aber nie für Ausländer. Da ich fast kein Wort verstehe, wäre es bei mir eh egal ... Und dann gibt‘s noch die Katzencafes, dort darf man gegen Geld eine halbe Stunde lang mit Katzen kuscheln ... und außerdem sogenannte Grapschbars! Da in der UBahn das Angegrapscht werden zum unangenehmen Alltag der Japanerin gehört, darf man das dort gegen Bezahlung legal machen. Aber alles nur für Japaner. Niemals für Ausländer. In den größeren Städten findet man Menschen mit guten Englischkenntnissen. Auf dem Land und in Kleinstädten geht allerdings fast nichts in Sachen Verständigung. Wenn man Glück hat, sind die Speisekarten zweisprachig. Sonst hat man ein Problem und muss sich mit Übersetzungen im Internet behelfen. Doch kommen wir zum Reisen durch ein Land der großen Gegensätze zu deutschen Umgangsformen. Um nur ein Beispiel zu benennen: wenn man in Deutschland ein öffentliches Verkehrsmittel benutzt, dann ist es selbstverständlich, den Platz für ältere oder gebrechliche Menschen frei zu machen. In Japan beleidigt man mit einer solchen Aktion den älteren Menschen, indem man ihm signalisiert, dass man ihn für alt und schwach hält.
-

Traditionelle Kostüme -

Japan - Selbstversuch in Kalligraphie -

Taiko-Trommler in Nagoya -

Speisenauswahl -

Shopping -

Markennamen -

Schaufenster -

Japanisches Essen
Aber nun zur Reise: In Tokio angekommen, ging es dieses Mal ins Hyatt Centric, ein Hotel in Superlage zu Restaurants und Shopping. Der Japaner shoppt gerne, allerdings Frauen und Männer getrennt. Es ist rührend, die Männer in unseren westlichen Luxusläden für ihre Frauen einkaufen zu sehen. Mit den Verkäuferinnen wird dabei garantiert mehr geredet, als mit der eigenen Ehefrau im ganzen Monat. Status ist extrem wichtig. Bei meinen 3 Japanbesuchen habe ich nur 2 Händchen haltende und sich küssende Paare gesehen. Eigentlich traurig. In den Großstädten ist immer etwas los, aber Städte in der Größe zum Beispiel von Wuppertal sind den ganzen Tag über wie ausgestorben - und davon gibt es viele. Wenn man wie ich mit dem Shinkhansen mehrfach quer durch‘s Land fährt, sieht man am meisten. Unendliche Reisfelder, in denen ganz nette Häuser liegen. Der Baustil ist ziemlich einfach und funktional. Leider sieht man die traditionellen schönen geschwungenen Hausdächer nur noch selten. In den dazu gehörigen Kleinstädten sind überall leergefegte Straßen. Nur am Bahnhof ist immer etwas los. Gegen Abend und Morgen sieht man in ganz Japan immer das gleiche Bild: Männer in Anzughose mit weißem Hemd, Kinder in Schuluniform und Frauen ziemlich langweilig, fast spießig gekleidet. Oft werden viel zu große Schuhe getragen, das soll das Erscheinungsbild besonders beim Mann vergrößern. Folglich wird darin geschlurft, sieht oft lustig aus. Eine Frau ist besonders sexy, wenn sie O-Beine hat, ganz schlimm „über den großen Onkel“ latscht und leicht verstört auf den Boden schaut, etwa wie ein 3jähriges Kind, das bei irgend etwas erwischt wird: Kindchenschema und Schulmädchensex. Fast grotesk. Passt aber wiederum perfekt zum Mangastyle. Wenn wir uns an Heidi erinnern, haben wir wirklich ein optisches Vorbild. Die Mangas sind Phantasiehelden von kids, hier können sie ihre Gefühle ausleben - Wut, Liebe, Zorn und Mitgefühl. Uns emotional ziemlich fremd ist auch das Halten und Mitführen von elektronischen Hunden in Japan.
Aber bleiben wir zunächst in Tokio. Natürlich muss man mal die berühmte sternförmige Shibuya Kreuzung besucht haben. Selfie klappt kaum, die Menschen hetzen von einer Seite auf die andere. Neben Hunderten von europäischen Läden - Finger weg wegen zu teuer - empfehle ich auch mal in ein typisches japanisches Kaufhaus zu gehen. Gibt‘s in jeder größeren Stadt. So etwas an schrecklichen Schuhen sieht man nie wieder. Man muss es sich anschauen. Was man allerdings gut kaufen kann, sind Regenschuhe. Da es dauernd schüttet, ist das Angebot riesig - auch von Hunter. Mein Lieblingsthema im Kaufhaus: Schirme und japanischer Kleinkram. Wenn bei uns ein Schirm vor allem regensicher sein soll, so ist er dort auf 90 Prozent sonneneinstrahlungsresistent getestet. Es gibt gefühlt und gesehen Hunderte von Modellen. So ist es auch mit Hüten und langen Ärmelstulpen gegen die Sonne. Wenn man in Japan aus dem Hotelfenster schaut und Massen an Schirmen sieht, dann ist schönes Wetter. Und nun zu meinen Lieblingsmitbringseln. In der oberen Etage befinden sich die Schul- und Küchenutensilien. Meine Kids lieben alles von da. Vor allem die Megalunchboxen. Und die Sushiradiergummis sind der Geschenkehit in Deutschland. Alles „sauteuer“ aber sowas von schön und nützlich. Ebenfalls unbedingt muss man gut essen gehen. Teppan ist sehr beliebt, genauso wie Tempurarestaurants, besonders lecker im „Tenichi“, die coolste Bar ist die „New York“ Bar im 52.Stockwerk des Hyatt. Tempurarestaurants liebe ich, weil nur in Japan und auch klasse für Vegetarier. Jedes Ding wird frisch nur für den Gast zubereitet. Und dann gibt es die traditionellen Restaurants. Das muss man mögen. Leicht fischig schmeckender Tofu, viel undefinierbares Essen mit teils wenig Geschmack - das ist meine Meinung. Ich persönlich kann in Ryokanhäusern - traditionellen japanischen Hotels - auf das Frühstück sehr gerne verzichten. Ein Fischauge liegt zum Beispiel um 6h morgens im-mer noch im Magen meines Mannes. Denn aus Höflichkeit muss alles gegessen werden. Da kann man zum „Blitzvegetarier“ werden. Trotzdem muss man mal in einem Ryokan übernachtet haben. Super. Und natürlich traditionell auf dem Boden schlafen. Einfach Klasse: nachts in der zimmereigenen heißen Quelle unter dem Dach zu sitzen: „über dir schüttet‘s und unter dir braust die See“. Dann weiß man aber auch: heiße Quellen heißt Erdbeben. Und von denen gibt‘s in Japan täglich mehrere 100! Ein Warner im Handy zeigt immer die aktuellen schwereren Beben an. In Nagoya hatte ich im 33. Stockwerk meines Hotelszimmers im Mariott ein Glas Wasser auf dem Tisch abgestellt. Plötzlich kam ein dumpfes Grummeln, dann rutsche das Glas einen Meter weit zur Tischkante und fiel herunter. Ich war geschockt, in Japan interessiert so etwas Läppisches aber niemanden. Überhaupt Nagoya: Hier gibt‘s eine tolle ziemlich neue japanische Burg. Fotomotiv! Eine Stunde weiter weg am Meer liegt besagtes Ryokanhotel mit heißer Quelle. Moderne Großstadt, „Toyota“ kommt daher. Unfassbar moderne Uni. Sogar die Atemluft der Studenten wird in Energie zur Warmwasserversorgung der Uni umgewandelt. Riesige Schaltzentralen zeigen an, wieviel Wasser wo verbraucht und hergestellt wird. Toyota hat diese Stadt technologisch voll im Griff und als Sponsor überall seine „Finger drin“. Das bringt der Stadt großen Wohlstand.
-

Tokio -

Kleiner traditioneller Schrein -

Kleiner japanischer Garten -

Goldene Pagode -

Japan - Tore des Fushimi-Inari-Schreins -

800 Jahre altes Feuer -

Tempo im Shinkhansen - Autorin Caroline Merz mit japanischer Begleitung
Von Nagoya geht es im Shinkhansen weiter nach Kyoto. Die neben Tokio wohl meist besuchte Stadt war jahrhundertelang die Hauptstadt Japans und ist meine japanische Lieblingsstadt. In Kyoto wurde auch die Teezeremonie erfunden. Und Matcha wird gemahlen. Ein Bombengeschäft! Alles mit und aus Matcha wird verkauft. Seife, Cremes, Kuchen, Tee, Brot, Eistees. Matcha ist allgegenwärtig und oft auch sehr lecker. Aber auch hier: geschenkt gibt es gar nichts. Natürlich ist die goldene Pagode ein Muss, aber die anderen Tempel sind oft nicht so überlaufen und nicht minder schön. Mir hat der FushimiInari Schrein mit den 1000 Toren am besten gefallen. Und abends ging‘s in das Vergnügungsviertel. Tolle Restaurants und Japan einmal offenherziger. Dafür mindestens 4 Tage einplanen. Auf Grund der feuchten Wärme und des vielen Grüns entwickeln sich die Grillen dort besonders gut. Megabrummer von circa 8 bis 10 cm. Unglaublich. Sie sind am Tag überall so laut, dass man sich oft anschreien muss.
Anschließend ging’s weiter nach Toyama. Liegt quasi gegenüber auf der anderen Landesseite von Tokio. Mit dem Zug fährt man durch endlose grüne Bergketten und an wunderschönen Seen vorbei. Und dann kommt die Stadt des rohen Fisches. Dafür ist Toyama bekannt. Allerdings nach 3 Tagen morgens, mittags und abends hatte ich mal wieder Lust auf etwas Warmes. Sonst hat diese Stadt nicht viel zu bie ten. Ein altes Schiff im Hafen und ein Felsen mit einem japanischen Baum drauf. Naja.
Was aber seit Neuestem interessant ist: ganz Japan hat einen unfassbaren Appetit auf Milch. Und da fast ausschließlich Fleisch gezüchtet wird, ist Milch wahnsinnig teuer. Natürlich auch alle Milchprodukte. An manchen Tischen standen morgens in den Hotels mehr als 10 (!) leer getrunkene Milchgläser bei 2 Gästen.
Fazit: Alles in allem ist das hier nur ein kleiner Querschnitt eines sehr interessanten und dringend besuchenswerten Landes. Ich glaube, Japan empfindet jeder anders. Das macht es sehr individuell und außergewöhnlich. Schon mein eigener Mann hat unterschiedliche Auffassungen. Was ich nie verstanden habe, sind sehr viele Blumen fotografierende Männer in den Parks. Und beim Hundegassiführen, meist in einer Art Kinderwagen, wird eine Minigießkanne für das kleine Geschäft mitgeführt! Also selbst hinfahren und sich ein Urteil bilden.
Für uns geht‘s nächstes Jahr nach Osaka, Nagasaki und Sapporo, wieder komplett anders.
„Sayonara“
Künstlerportrait: Elisabeth Brockmann
Elisabeth Brockmann: Künstlerin / Art in Architecture
Elisabeth Brockmann hat in den 70er-Jahren Malerei bei Gerhard Richter studiert. Nach Aufenthalten in New York und Paris sowie einem Lehrauftrag an der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe betreibt sie ihre Ausstellungstätigkeit im In- und Ausland von Düsseldorf aus.
-


Drei-Scheiben-Haus in Düsseldorf -


Entwurf
Mit spektakulären Leuchtobjekten inszeniert sie öffentliche Räume und Fassaden, z.B. „Keep in View“ am Dresdner Albertinum (seit 2002) oder „Lux“ am Reiss-Engelhorn-Museum in Mannheim (seit 2007).
-


KEEP IN VIEW - sechsteilige Installation am Albertinum in Dresden, seit 2001 -


Elisabeth Brockmann
„Sie ist „bekannt für ihre ‚großen‘ Überraschungen im architektonischen Kontext“, schreibt die DIE WELT. In ihren Lichtbildnissen geht es ebenso wie in ihren literarischen Texten um den schmalen Grat zwischen Wirklichkeit und Projektion.
Sie wird von der Münchner Galerie Wittenbrink vertreten.
| Titelbild oben: LUX - Reiss-Engelhorn-Museum, Mannheim, 50teilige Lichtinstallation, seit 2007 |
"Im Spiel ist man frei"
Interview mit der Schauspielerin Alexandra von Schwerin
von Dr. Susan Tuchel
Sie wurden in Stuttgart geboren, wuchsen aber in Vorarlberg in Österreich auf. Eine Kindheit wie im Bilderbuch?
Ja, auf jeden Fall. Wir waren eine ganz klassische 60er Jahre-Familie mit Vater, Mutter, zwei Kindern, einem Opel und einem Häuschen im Grünen. Keiner aus unserer Familie hatte etwas mit Kunst im Sinn. Mein Vater arbeitete als Manager für Bayer Leverkusen in Dornbirn. Meine Mutter war Hausfrau, hielt als Schwäbin das Geld zusammen und lehrte uns Kinder Bescheidenheit.
Dabei stammen Sie aus einem deutschen Adelsgeschlecht, dessen Stammbaum sich immerhin bis ins 12. Jahrhundert zurückverfolgen lässt.
Ja, es gibt aktuell noch an die 300 Schweriner, die sich alle zwei Jahre treffen. Die Pflege der Tradition hat allerdings mein Bruder übernommen. Ich war schon als Jugendliche eher eine Revoluzzerin und wusste auch erst überhaupt nicht, was ich werden wollte. Dann habe ich ein Semester auf Hawaii studiert und dort eine Theateraufführung gesehen, die am Rande eines Kraters stattfand. Das hat mich fasziniert, und mir gefiel die geschützte Atmosphäre in dem Theaterraum so gut, dass ich beschloss, Theaterwissenschaften zu studieren. Zurück in Österreich entschied ich mich, nach Berlin zu gehen. Berlin war schon damals sehr hipp und so packte ich meinen Rucksack und trampte dorthin. Was ich nicht wusste: In Berlin gab es für Theaterwissenschaften einen Numerus Clausus von 1,6. Ich fing an, mich politisch zu engagieren und war zeit-weise in der Hausbesetzerszene aktiv.
Wie sind Sie dann zur Hochschule der Künste in Berlin gekommen?
Über einige Umwege und eine Zufallsbekanntschaft. In New York hatte ich in einer russischen Kneipe einen Amerikaner kennengelernt, der in einer deutschen Theatergruppe spielte. Klingt verrückt, war aber wirklich so. Den habe ich dann in Berlin angerufen, und er hat sich mit mir getroffen. Dann bin ich ein Jahr mit seiner Theatergruppe unterwegs gewesen, so als Mädchen für alles. Als dann eine Schauspielerin ausfiel, sprang ich ein und fühlte mich von der ersten Minute an wohl auf der Bühne. Ich lernte in meinem Umfeld immer mehr Schauspieler kennen, die sich für die Aufnahmeprüfung an der Hochschule der Künste in Berlin vorbereiteten. Ich habe mit ihnen Stücke geprobt und Monologe eingeübt und mich dann auch be-worben. Von den 800 Bewerbern wurden elf genommen und ich war dabei.
Erinnern Sie sich noch an Ihre ersten Aufführungen?
Da taucht vor meinem geistigen Auge sofort die Rolle der Cordelia in „King Lear“ auf. In dieser Shakespeare-Inszenierung von Robert Wilson am Schauspielhaus Frankfurt spielte Marianne Hoppe den König Lear und Christoph Waltz und Richie Müller waren die beiden Söhne von Gloster.
Zur Karriere auf der Bühne kam dann die Fernsehkarriere. Aktuell sind Sie in der Serie „Professor T“ mit Matthias Matschke im ZDF zu sehen, außerdem in der ARD-Serie „Phönix-See“ und in „Helen Dorn“. Was macht für Sie den Unterschied zwischen Bühne und Film aus? Was reizt Sie mehr?
Es hat beides seinen Reiz, aber es sind auch zwei Paar Stiefel. Die Kamera sieht in den Kopf hinein, auf der Bühne arbeitet man stärker mit veräußerlichten Mitteln, da müssen Sie auch schon mal „draufdrücken“. Aber auch die Bühne wird heute psychologischer, gleicht sich in Vielem dem Film an.
Bis zum 17. November stehen Sie in Düsseldorf mit Jochen Busse, Hugo Egon Balder, René Heinersdorff und Katarina Schmidt auf der Bühne, übrigens zum 25-jährigen Jubiläum des Theaters an der Kö. Sie sind eine der beiden starken Frauen, die in „Komplexe Väter“ für Ordnung im emotionalen Chaos sorgen. Ist das Neuland für Sie?
Ja, es ist mein erstes „klassisches“ Boulevardstück. 2018 habe ich in einem Zwei-Personenstück mit Mathieu Carrière in der Komödie im Bayerischen Hof in München gespielt. Da hat mich René Heinersdorff gesehen, mich ein paar Tage später angerufen und mir eine Rolle in seiner Komödie „Komplexe Väter“ angeboten, und ich habe angenommen. Und seitdem touren wir mit dem Stück durch Deutschland. Die Premiere war in Hamburg, dann waren wir am Berliner Schillertheater und in Köln am Theater am Dom. Wir haben vor ausverkauften Häusern gespielt. Das Stück funktioniert und die Leute haben Spaß daran. „Komplexe Väter“ ist richtig gutes Boulevardtheater und René hat mir viel beigebracht.
Was denn genau?
Dass man im Boulevard viel offensiver auf das Publikum zugehen muss. Das ist schauspielerisch schon sehr interessant und war für mich eine ganz neue Dimension des Spielens.
Sie arbeiten das erste Mal hier in Düsseldorf. Was mögen Sie als Wahl-Kölnerin an Düsseldorf?
Ich gehe hier sehr gerne japanisch essen, und mein Partner und ich besuchen regelmäßig das K21, da er Künstler ist. Wir kennen uns aus dem Studium, haben einen 22-jährigen Sohn, der in Dortmund Fotografie studiert. Weil wir beide aus der Hausbesetzerszene kommen und immer noch eine „Kreuzberger Denke“ haben, blieb es bei der Partnerschaft ohne Trauschein, bei Urlauben im Defender mit Dachzelt und Blick in den Sternenhimmel.
Sie sind seit 16 Jahren freiberufliche Schauspielerin und haben 2006 eine Schauspielschule für Kinder und Jugendliche in Köln gegründet. Sie geben dort Workshops, haben aktuell Engagements in Stuttgart am Staatstheater, wo Sie in „100 Songs“ von Roland Schimmelpfennig mitspielen, stehen bis November hier in Düsseldorf auf der Bühne und zwischendurch immer wieder vor der Kamera. Woher nehmen Sie die Kraft und Energie?
Ich finde meinen Beruf nie anstrengend und sehr abwechslungsreich. Auf der Bühne oder vor der Kamera zu stehen ist für mich wie Urlaub, weshalb ich wohl auch schon länger keinen mehr gemacht habe. Auch wenn es in der Freiberuflichkeit Aufs und Abs gibt, genieße ich meine Freiheit sehr. Die Schauspielschule habe ich aus Leidenschaft gegründet. Es ist einfach phantastisch zu sehen, wie gefestigt und selbstbewusst die Kinder sind, wenn sie einen Schauspielkursus besucht haben. Sie nehmen eine Menge mit für ihren Lebensweg, denn auf der Bühne zu stehen und zu spielen macht frei. Ich sehe das Spiel auf der Bühne als ein Gegengewicht zu den Ängsten, die vor allem Heranwachsende umtreiben. Einige Kinder und Jugendliche bereiten wir in der Sprachschule „juniorhouse“ auf Aufnahmeprüfungen an Schauspielschulen vor, und einige unserer ehemaligen Schüler haben mittlerweile Engagements an Theatern in Kiel, Kaiserslautern und Mainz. Das ist eine schöne Bestätigung meiner Arbeit und bringt mich auch in meinem Spiel und damit auch in meinem Leben weiter.
Kurzvita


Fotos: Alexander Vejnovic, Schauspielerportraits
„Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, sondern auch für das, was wir nicht tun“
Interview mit Marion Warden, Kreisgeschäftsführerin der AWO in Düsseldorf
von Evelin Theisen
Das Thema „Frauen in leitenden Positionen“ ist derzeit sehr präsent. Du gehörst dazu mit der verantwortungsvollen Aufgabe der Kreisgeschäftsführerin der AWO in Düsseldorf. Davor warst du als Mitglied des Landtags NRW für die SPD tätig. Welche Ziele sind dir wichtig und wie konntest du sie bisher erreichen?
Meine Motivation zum persönlichen Engagement lag immer schon darin, bestehende Verhältnisse zu Gunsten einer besseren Lösung zu verändern. Als Schülersprecherin am Comenius-Gymnasium genauso wie später als Sachbearbeiterin im Sozialamt, im Rahmen von Führungsaufgaben in der Verwaltung oder im politischen Bereich. Dazu ist viel Geduld und Überzeugungskraft nötig – und natürlich gelingt nicht immer alles, was man gerne möchte. Wichtig ist mir, dass vor allem junge Menschen eine Chance im Leben erhalten, unabhängig von den familiären Voraussetzungen. Dafür lohnt sich der Einsatz immer. Bei der AWO haben wir übrigens mehr als 1.200 Jugendliche in unterschiedlichen Projekten und Maßnahmen. Wir sind einer der größten Ausbildungsbetriebe der Stadt.
Besonders in der Politik bilden ja die Männer immer noch die große Mehrheit. Wie kann man das ändern?
Das ist ein langer Weg, aber in den letzten Jahrzehnten ist ja auch schon viel geschehen. Wir haben derzeit viele junge, aktive und gut ausgebildete Frauen bei der AWO und auch in der SPD sowie bei den anderen Parteien aber auch auf gesellschaftlicher Ebene. Die müssen wir fördern und ihnen Perspektiven bieten – vor allem zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Aber wir müssen auch an die jungen Männer denken. Auch sie müssen einbezogen werden.
Welche Ratschläge würdest du interessierten Frauen geben, die gerne politisch tätig werden möchten?
Einfach kommen, dabei sein und mitmachen – die Parteien sind froh über jedes Engagement. Und die Gemeinschaft entwickelt sich dann auch. Gute Infos gibt es über Social Media zu den Zielen und Schwerpunkten der politischen Parteien.
Dein Aufgabengebiet ist jetzt Geschäftsführerin bei der AWO. Dies ist eine große deutsche Organisation und als traditioneller Wohlfahrtsverband bekannt. Wie kann man die Aktivitäten insgesamt kurz umreißen?
Die AWO Düsseldorf hat rund 1.600 hauptberufliche Beschäftigte in vier Tochtergesellschaften und 134 Einrichtungen im Stadtgebiet, weiter-hin 2.000 Mitglieder in 14 Ortsvereinen und rund 700 ehrenamtlich Engagierte. Wir haben zum Beispiel 26 Kindertagesstätten, übernehmen die Betreuung im offenen Ganztag an circa 30 Schulen, betreiben mehrere stationäre Senioren- und Behinderteneinrichtungen, eine Tagespflege und verschiedene ambulante Wohnprojekte. Wir bieten Hilfe zur Erziehung, ein Familienbildungswerk mit zahlreichen Angeboten, Jugend- und Elternberatung. Darüber hinaus haben wir auch Angebote im Bereich Migration und Integration und vieles mehr. Wir sind sehr vielfältig und immer unter dem Leitsatz „Miteinander - Füreinander“.
Wo wird Hilfe heute am dringendsten benötigt?
Schwerpunkt muss die frühkindliche Entwicklung und Bildung sein. Aber wir dürfen auch die Familien in schwierigen sozialen Lebenssituationen nicht aus dem Blick verlieren und uns vor allem um das Wohl älterer und pflegebedürftiger Menschen bemühen.
Welche Arbeits- und Aufstiegschancen bieten sich den Mitarbeitern bei der AWO?
Wir erarbeiten derzeit ein komplexes Personalentwicklungskonzept, um neue Perspektiven und Aufstiegschancen zu eröffnen. So bieten wir fachbezogene Fortbildungen aber auch solche im Bereich der Mitarbeiterführung an. Geplant sind unter anderem der Aufbau eines betrieblichen Gesundheitsmanagements und einer eigenen Sozial- und Pflegeberatung für unsere Beschäftigten. Wir haben da noch einiges vor! Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind das wichtigste Potential.
Ist es möglich, in so einer großen Organisation eigene Ideen und Vorschläge zu realisieren?
Ja, warum nicht?
Kurzinfo: Die AWO
|
Kurzvita


„Die Attraktivität von Düsseldorf ist ungebrochen“
Interview mit Thomas Geisel, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Düsseldorf
von Dr. Siegmar Rothstein
Sie sind seit nahezu seit fünf Jahren Oberbürgermeister unserer Stadt. Bei Ihren früheren Tätigkeiten in der Wirtschaft konnten Sie weitgehend entsprechend Ihrer eigenen Auffassung allein entscheiden. Die Politik lebt jedoch vom Kompromiss, da in der Regel eine Partei nicht allein regiert. Fällt Ihnen die Umstellung schwer, vor allem, wenn Sie auch Auffassungen berücksichtigen müssen, die Sie eigentlich voll ablehnen?
Nun, ganz so groß ist der Unterschied auch wieder nicht. Wenn Sie etwas erreichen wollen, müssen Sie in der Regel auch andere mitnehmen. Und da kommt es ganz maßgeblich auf die Überzeugungskraft Ihrer Argumente an. Das ist in der Politik nicht grundsätzlich anders als in der Wirtschaft. Natürlich spielen in der Politik bisweilen auch Gesichtspunkte mit, die eher parteipolitisch oder taktisch motiviert sind. Insgesamt aber bin ich mit dem, was wir in Düsseldorf – Verwaltung und Politik gemeinsam – erreicht haben ganz zufrieden. Und bei Auffassungen, die ich voll ablehne, habe ich nach meiner Erinnerung in den letzten fünf Jahren keine Kompromisse gemacht.
Der frühere USA Präsident John F. Kennedy hat nach einiger Zeit in seinem Amt erklärt, er sei doch sehr überrascht, wie wenig er seine persönlichen politischen Ansichten durchsetzen und auf den Gang der Verwaltung Einfluss nehmen könne. Haben Sie als Oberbürgermeister bei Ihrer täglichen Arbeit eine ähnliche Erfahrung gemacht?
Natürlich hat jede Verwaltung ein gewisses Eigenleben. Insofern ist es wichtig, dass man klar signalisiert, was man vorhat und gelegentlich auch einmal durchgreift. Dies ist bei einer Kommunalverwaltung naturgemäß etwas einfacher, als bei großen Verwaltungsapparaten. Soweit ich das beurteilen kann, sind die Verselbständigungstendenzen der Verwaltung in Land und Bund stärker ausgeprägt, als in unserer Stadtverwaltung. Und noch schlimmer dürfte es wohl in der Bundesverwaltung der Vereinigten Staaten sein, unter der John F. Kennedy zu leiden hatte.
Sie regieren in einer Kooperation von SPD, FDP und Grünen. Sind Sie mit der Zusammenarbeit zufrieden? Man kann den Eindruck haben, dass FDP und Grüne Sie nicht unkritisch begleiten, Sie zum Teil sogar heftig kritisieren. Berührt Sie Kritik, wenn Sie sie für ungerechtfertigt halten?
Grundsätzlich bin ich mit der Zusammenarbeit in und mit der Ampel-Ko-operation ganz zufrieden. Gemein-sam haben wir viel erreicht. Dass von Seiten der Grünen und der FDP bisweilen Kritik an meiner Amtsführung geleistet wird, finde ich nicht überraschend. Erfahrungsgemäß haben insbesondere kleinere Parteien und Fraktionen ein besonders ausgeprägtes Bedürfnis, sich hin und wieder zu profilieren. Dass deren Kritik – ich denke insofern an die Rolle der FDP bei der Tour der France oder die Position der Grünen in der Frage des Ed-Sheeran-Konzerts - aus meiner Sicht der Sache nicht gerecht wurde, damit muss man leben. Dass insbesondere vor Wahlen eher das Trennende als das Verbindende he-rausgestellt wird, liegt wohl auch in der Natur der Sache. Im Interesse der Stadt freilich wäre es, wenn die Ampel so lange wie möglich halten würde - jedenfalls solange die CDU sich in erster Linie als Fundamental-opposition versteht.
Zur Zeit ist in aller Munde die Klage über den Mangel an bezahlbarem Wohnraum insbesondere in den Städten. Sieht die Stadt Düsseldorf Möglichkeiten und - gegebenenfalls - welche, einen Beitrag zur Beseitigung der Unterversorgung zu leisten? Geben Sie in Grundstückskaufverträgen vor, ob und wie der Käufer zu bauen hat?
Sie haben völlig recht: In Düsseldorf gibt es in der Tat eine Unterversorgung. Und deshalb können wir den Preisanstieg bei den Mieten nur dadurch eindämmen, dass wir bei anhaltend hoher Nachfrage auch das Angebot deutlich erhöhen. Des-halb haben wir den Wohnungsbau in den letzten fünf Jahren drastisch angekurbelt. Mittlerweile erreichen wir das Ziel, nachhaltig jedes Jahr 3.000 neue Wohnungen dem Wohnungsmarkt hinzuzufügen, und im letzten Jahr haben wir erstmals seit Jahrzehnten mehr Sozialwohnungen gebaut, als aus der Sozialbindung herausgefallen sind – und uns da-mit vom Negativtrend anderenorts abgekoppelt.
Ganz einfach ist das nicht, denn bei praktisch jedem größeren Wohnungsbauvorhaben regt sich Widerstand, der entweder gar keine Bebauung zulassen möchte oder lediglich eine deutlich geringere Anzahl an Wohnungen. In punkto bezahlbaren Wohnraums stellen wir durch das „Handlungskonzept Wohnen“ sicher, dass bei allen Wohnungsbauprojekten mindestens 40 Prozent Wohnungen im preisregulierten Segment, also als Sozial-wohnungen oder Wohnungen mit preisgedämpften Mieten, errichtet werden. Hinzu kommt, dass wir die städtische Wohnungsbaugesellschaft deutlich gestärkt haben und sie prioritär berücksichtigen, wenn städtische Grundstücke veräußert werden. Wohnungen im kommunalen Eigentum haben den großen Vor-teil, dass sie langfristig dem Gemein-wohl verpflichtet bleiben.
Bei Ihrem Amtsantritt haben Sie in Aussicht gestellt, sich besonders mit der Verkehrspolitik zu beschäftigen, insbesondere das Fahrradfahren und den öffentlichen Nahverkehr zu fördern. Sie haben einiges auf den Weg gebracht, dennoch wird Ihnen vorgeworfen, Sie hätten es bei wachsendem Verkehr nicht geschafft, die dringend notwendige Verkehrswende zu beginnen, es fehle am Generalplan für den Verkehr. Andererseits wird kritisiert, dass der Fahrradverkehr zu Lasten des Autoverkehrs zu stark begünstigt wird. Auf welche Verkehrspolitik darf man sich in Zukunft in Düsseldorf einstellen?
Die Verkehrswende gehört in der Tat zu den dickeren Brettern, die es in der Kommunalpolitik zu bohren gilt, zumal dann, wenn diejenigen, die sich über zu langsame Fortschritte beklagen, häufig die größten Bremser sind. Ich möchte in diesem Zusammenhang nur an die Diskussion über Anliegerparken und Parkraumbewirtschaftung oder über sogenannte „protected bike lanes“ erinnern. Aus meiner Sicht hat Ideologie in der Verkehrspolitik nichts zu suchen. Deshalb machen wir keine Anti-Auto-Politik. Allerdings kann sich niemand der Erkenntnis verschließen, dass der motorisierte Individualverkehr, also das Auto, nicht mehr das Verkehrsmittel der Wahl sein kann in einer Metropole, die einerseits immer dichter bebaut wird und andererseits immer größeren Wert auf die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum legt. Deshalb muss es Ziel unserer Verkehrspolitik sein, die Infrastruktur und das Angebot für Fahrrad, Bus und Bahn so weiter zu entwickeln, dass die Menschen auf das Auto verzichten können. In diesem Zusammenhang erweitern wir das Stadtbahnnetz um die U 81, investieren in neue Straßenbahnen und moderne Busse, verdichten wir den Takt bei Bus und Bahn und bauen das Radwegenetz weiter aus.
Düsseldorf befindet sich in einem sehr befriedigenden Zustand. Es hat den Lebensstandard gehalten und sogar verbessert, die Stadtentwicklung ist auf einem sehr guten Weg. In diesem Jahr wollen Sie weniger ausgeben als einnehmen. Wo sehen Sie Düsseldorf in der Zukunft? Was sollten die Prioritäten in den nächsten Jahren sein?
Die Attraktivität von Düsseldorf ist ungebrochen. Deshalb wird unsere Stadt weiter wachsen. Mir ist es wichtig, dass alle Stadtteile Düsseldorfs an dieser insgesamt sehr positiven Entwicklung teilhaben. Des-halb werden wir in allen Stadtteilen Wohnungen bauen, in Schulen und Kindergärten investieren und die soziale, kulturelle und Verkehrsinfrastruktur weiter entwickeln. Natürlich wird es auch in Zukunft in Düsseldorf städtebauliche Leuchtturmprojekte geben. Eines davon ist der sogenannte „blau grüne Ring“, ein anderes die Weiterentwicklung des Düsseldorfer Hafens. Und natürlich hat Düsseldorf den Anspruch, bei der digitalen Transformation Maß-stäbe zu setzen. Wir wollen uns zu einer Smart City entwickeln mit einer vorbildlichen digitalen Infrastruktur, einer bürgerfreundlichen - besser gesagt: kundenorientierten – Verwaltung und einem barrierefreien und emissionsarmen integrierten Mobilitätssystem.
Sie sind bis September 2020 gewählt und haben erklärt, sich der Wiederwahl zu stellen. Der Land-tag hat mit den Stimmen der CDU/FDP Koalition die Stichwahl abgeschafft. Es kommt also nicht mehr zu einem zweiten Wahlgang, bei dem die beiden bestplazierten Kandidaten antreten. Ihre Partei will die Entscheidung des Landtages gerichtlich überprüfen lassen. Ist aber nicht die jetzt gefundene Regelung für Sie von Vorteil, weil der sogenannte Amtsbonus Ihnen helfen könnte, im Ergebnis die meisten Stimmen zu erhalten? Bei der letzten Wahl wäre Ihr Amtsvorgänger Oberbürgermeister geblieben, weil er im ersten Wahlgang die meisten Stimmen erhalten hat und erst im zweiten Wahlgang unterlegen war.
Es trifft wahrscheinlich zu, dass durch die Abschaffung der Stich-wahl der Amtsinhaber tendenziell begünstigt wird. Dennoch halte ich die Abschaffung der Stichwahl nicht nur für einen schweren Fehler, sondern für einen Bärendienst an der Demokratie. Zum einen finde ich die Vorstellung schwer erträglich, dass ein Oberbürgermeister gewählt sein kann, der vielleicht gerade einmal etwas mehr als ein Viertel der abgegebenen Stimmen auf sich vereinen konnte. Vor allem aber befürchte ich, dass sich die Parteien durch die Ab-schaffung der Stichwahl veranlasst sehen könnten, sich zu politischen „Lagern“ zusammenzuschließen, um mit einem gemeinsamen Kandidaten bessere Chancen zu haben. Im Ergebnis würde dies dazu führen, dass die Kandidatenauswahl das Ergebnis eines Kompromisses zwischen Parteifunktionären wird. Ein völlig unbekannter Kandidat, wie ich es 2014 war, hätte dabei, befürchte ich, keine Chancen.
Sie haben sich zu dem Grundsatz bekannt, erst die Stadt dann die Partei. Kürzlich wurde der Vorstand Ihrer Partei neu gewählt. Sie haben sich nicht zur Wiederwahl gestellt. Hier gab es Spekulationen, dass Ihr Rückzug nicht freiwillig, sondern auf Druck der Genossen erfolgt sei.
Das ist – mit Verlaub – Quatsch. Als Oberbürgermeister kann ich an allen Gremiensitzungen meiner Partei teilnehmen, auch ohne ein formelles Parteiamt zu bekleiden. Und ganz ehrlich: Mein Terminkalender ist durchaus so gefüllt, dass mir nicht danach ist, mich in zusätzliche Auf-gaben und Funktionen zu drängen.
Es wird berichtet, Ihr Vater sei skeptisch gewesen, dass Sie es als Schwabe im Rheinland nicht leicht haben würden. Sie wohnen schon lange im Rheinland. Hatten Sie irgendwann einmal den Eindruck, als Schwabe nicht angenommen zu werden? Schlägt Ihr Herz gelegentlich noch ein wenig schwäbisch?
Meine Familie und ich haben uns vom ersten Tag an in Düsseldorf sehr wohl gefühlt. Natürlich gibt es keinen Grund, meine schwäbische Herkunft zu verleugnen und Maultaschen und Spätzle gehören nach wie vor zu meinen Leibspeisen. Umso mehr schätze ich, dass unsere Stadt so weltoffen ist, dass sie einen Oberbürgermeister mit schwäbischem Migrationshintergrund gewählt hat (lacht).
Sie üben ein anspruchsvolles politisches Amt aus, das sicher nicht selten heftig an Ihren Kräften zehrt, so zum Beispiel, als Sie nach einer Talkrunde bei Anne Will von Berlin nach Mitternacht in fünf Stunden im PKW nach Düsseldorf gefahren werden mussten, da am nächsten Tag ab 8 Uhr wichtige Termine auf Sie warteten. Auch Ihre Freizeitgestaltung ist nicht gerade gemütlich: Sie laufen einen Marathon in Bos-ton und nach knapp zwei Wochen einen Halbmarathon in Düsseldorf. Wie schaffen Sie all Ihre Aktivitäten? Wie verkraften Sie Ihre hohe Schlagzahl? Verraten Sie uns die Quelle, worauf Sie Ihre hohe Vitali-tät zurückführen?
Der liebe Gott hat mich glücklicherweise mit guter Gesundheit und guter Kondition und einem nicht sonderlich ausgeprägten Schlaf-bedürfnis ausgestattet. Und noch wichtiger für dieses Amt ist vielleicht die Fähigkeit, auch einmal abschalten zu können. Wenn ich bei meiner Frau und meinen Kindern bin, bin ich eben nicht Oberbürgermeister, sondern ein Familienvater, der das Glück hat, eine großartige Frau und fünf wunderbare Töchter zu haben. Das ist ein Segen.
Kurzvita


"Im Boulevard kann ich machen, was ich will"
Interview mit dem Schauspieler Jaques Breuer
von Dr. Susan Tuchel
Sie stammen aus einer alten Schauspieler- und Künstlerdynastie. Ihr Urgroßvater war Opernsänger und Taufpate von Siegfried Wagner, dem Sohn von Richard und Cosima Wagner. Ihr Großvater Siegfried war an der Seite von Joseph Cotten und Orson Welles in „Der dritte Mann“ zu sehen. Was war mit Ihren Eltern?
Mein Vater Siegfried Breuer junior hat in „Die Deutschmeister“ mit der jungen Romy Schneider gespielt. Er war laufend auf Tournee. Meine Mutter, eine Französin, hat nach meiner Geburt zwar nicht mehr geschauspielert, aber trotzdem lebten mein Bruder Pascal und ich in einem Künstlerhaushalt und mussten uns dauernd auf etwas Neues einstellen. Auf Erziehung und feste Regeln haben meine Eltern nicht unbedingt den Fokus gelegt, auch die Ehe war problematisch. Die Folge war, dass ich Schwierigkeiten in der Schule bekam. Ich wollte möglichst schnell raus aus der Familie, arbeiten und mein eigenes Geld verdienen. Mein Vater hat mir dann geholfen, dass ich mit 16 Jahren die Aufnahmeprüfung bei der Otto-Falckenberg-Schule schaffte. Ab da fing mein Leben an: Ich konnte die Einöde von Erdinger Moos hinter mir lassen, in München leben und schauspielern – das, was ich immer wollte. Ich hatte die besten Lehrer und stand schon als Schauspielschüler in Brechts „Die Gewehre der Frau Carrar“ an den Münchener Kammerspielen auf der Bühne. Dann wurde ich Ensemblemitglied beim Bayerischen Staatsschauspiel, da war ich dann das Nesthäkchen.
Und Ihre Karriere beim Film?
Ich hatte schon als Kind des Öfteren vor der Kamera gestanden, das erste Mal mit sechs Jahren. Und immer wenn ich konnte, habe ich meinen Vater begleitet und viele Schauspieler kennengelernt, darunter auch O.W. Fischer. Dann ist der Filmproduzent Helmut Ringelmann auf mich aufmerksam geworden. Ringelmann war in Göttingen der Privatassistent meines Großvaters und hat mir bei meiner Fernsehkarriere geholfen.
Und für welche Karriere schlägt Ihr Herz?
Ich liebe Theater und Film, aber es sind sehr unterschiedliche Welten. Beim Film liebe ich die Art, wie man einen Film macht. Ich mag die Studioatmosphäre. Allerdings hat sich in den letzten Jahren vieles verändert. Man produziert heute unter großem Zeitdruck und muss wie eine Maschine funktionieren, das liegt mir nicht. Ich mache lieber kleine, feine Sachen wie beim Boulevard. Da kann ich machen, was ich will und das fordert mich. Boulevardtheater zu spielen ist technisch das Schwierigste, was es gibt. Und wenn es funktioniert und das Publikum begeistert ist, gibt mir das die größte Befriedigung.
Wie kamen Sie ans Theater an der Kö und seit wann kennen Sie René Heinersdorff?
Wir haben in den 80ern „Derricks“ zusammen gedreht. Wir spielten damals beide suspekte Verdächtige. Ich bewundere René als Schauspieler und dafür, dass ihm mittlerweile beim Boulevard keiner mehr das Wasser reicht. Mit dem Theater an der Kö fühle ich mich sehr verbunden und habe bereits drei Stücke dort gespielt. Das Stück „Funny Money“ ist beim Publikum so gut angekommen, dass René überlegt, es nächstes Jahr im Theater im Rathaus in Essen aufzuführen.
Haben Sie im Laufe der Jahre Lieblingsorte in Düsseldorf für sich entdeckt?
Auch wenn ich mit Leib und Seele Bayer bin, mag ich Düsseldorf sehr. Mit meiner Hündin Pipa, die im Frühjahr mit mir zusammen in der Künstlerwohnung auf der Hohe Straße gewohnt hat, habe ich immer neue Ecken entdeckt. Ich bin gerne die Kö entlanggeschlendert oder bin an den Rhein gegangen. Bei diesen Erkundungstouren habe ich meistens Hörbücher im Ohr, weil ich mich als Synchronsprecher immer wieder mit Filmen und Literatur beschäftige.
Sie sind einer der gefragtesten Synchronsprecher Deutschlands. Sie waren die deutsche Stimme von John C. Reilly im Kinofilm „Der Gott des Gemetzels“ und haben Viggo Mortensen in „Greenbook“ Ihre Stimme geliehen. Was bedeutet Synchronsprechen für Sie?
Das ist eine ganz besondere Art, in Literatur oder Filme einzutauchen. Ich suche immer nach Möglichkeiten, die Besonderheiten der Sprache auch in der Synchronisation rüberzubringen. Das fällt natürlich leichter, wenn es sich um englische und französische Filme handelt, aber ich habe auch schon chinesische und iranische Filme synchronisiert. Auch diese Filme möchte ich begreifen – das ist eine sehr gute schauspielerische Übung.
Sie haben einen französischen Vornamen, Ihre Mutter kommt aus der Normandie, gibt es dazu eine schöne Geschichte?
Meine Mutter hatte im Krieg als Krankenschwester in einem Lazarett gearbeitet und ist dann mit einem deutschen Arzt nach Deutschland gegangen. Um nicht als Kollaborateurin in Verdacht zu geraten, hat sie alle Brücken zu ihrer Familie abgebrochen. Vor 15 Jahren rief mich eine Frau an und sagte: „Ich bin Deine Tante.“ Sie hatte meinen Namen im Abspann eines Films gesehen und weil ich meiner Mutter so ähnlich sehe, hat sie Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um mich zu finden. Seitdem habe ich eine riesige Verwandtschaft in Paris und Rouen. Meine Tanten und 25 Cousinen und Cousins haben mich aufgenommen wie einen verlorenen Sohn.
Wofür engagieren Sie sich?
Für ein Ende der Massentierhaltung. Ich gehe auf Umweltschutz- und Greenpeace-Demos und unterstütze Hannes Jaenicke immer wieder bei seinen Umweltaktivitäten. Ich bin Mitglied bei Sea Shepherd, denn als Segler weiß ich sehr genau, wie es um den Fischbestand unserer Meere bestellt ist.
Was kommt nach „Schein oder Nichtschein“, wo Sie noch bis Ende Juni in der Komödie in Frankfurt zu sehen sind?
Danach geht es mit „1984“ auf Deutschlandtournee. Außerdem reise ich viel, um mir anzuschauen, wohin ich mich nach meinem letzten Bühnenauftritt zurückziehen möchte. Mein derzeitiger Auswanderungsfavorit ist die Algarve im Süden Portugals.
Kurzvita


„Bei meiner Kunst gebe ich mein Bestes und suche die Vollendung“
Interview mit dem Maler und Bildhauer Markus Lüpertz
von Dr. Paul Breuer
| Zwei schlaksige Jungen, so um die 14 Jahre, bewegten sich von der Realschule Mönchengladbach nach Hause in Rheydt. Immerhin fünf bis sechs Kilometer Fußmarsch. Markus mit der Zeichenmappe unterm Arm, und ich mit der typischen, vollgepackten Schultasche, die man damals in der Hand und nicht auf dem Rücken trug. Das Gewicht der Bücher brachte meinen schmächtigen Körper fast in Schieflage. Kurz bevor sich unsere Wege trennten, fragte ich Markus, was denn in der Zeichenmappe zu sehen sei. Etwas zögerlich öffnete er sie und zeigte mir einige Bleistift-/Kohlezeichnungen. Es waren männliche Aktzeichnungen. „Wahrscheinlich vor dem Spiegel gezeichnet“, schoss es mir durch den Kopf. Nachdenklich und leicht irritiert ging ich nach Hause. Und das sollte Kunst sein? Meine frühesten Erinnerungen an dieses Fach reichten in die Zeit mit Ernst Fuchs zurück, dem österreichischen Maler, der zeitweise bei uns Zuhause in Wien wohnte und der als 16-Jähriger eine Reihe Portraits, unter anderem von mir, dem Fünfjährigen, in Kohle zeichnete. Markus trug schon damals einen Ohrring - so wie zum Beispiel Seeräuber in alten Illustrationen dargestellt wurden. In dieser verklemmten Zeit und in diesem jugendlichen Alter mit einem Ohrschmuck herumzulaufen, setzte Mut voraus, starkes Selbstbewusstsein sowieso. Dass viele Jahre später er als einer der bekanntesten deutschen Maler und Bildhauer, umstritten wie bewundert, mir zum Interview gegenübersitzen würde, konnte keiner von uns auf dem Schulweg damals voraussehen. |
Welche Erinnerungen hast du an die Fünfziger Jahre?
Resopalbeschichtete Nierentische, Milchbars. Ein ‘Born to be wild”-Gefühl im Bauch. Ich weiß, der Film Easy Rider kam erst Ende der 60er-Jahre in die Kinos, aber irgend-wie entsprach dieser Freiheits- und Unabhängigkeitsdrang meinem jugendlichen Übermut schon in den Fünfzigern. Ich war halt immer schon meiner Zeit voraus. (Lacht) Ich will nicht, wie so viele ältere Menschen, in ein ‚früher war alles besser’, verfallen. Jede Zeit erzielt an Mehrwert nur, was die Menschen aus ihr machen. Deshalb ist mein Blick nach vorne gerichtet. Ich komme nirgendwo an und suche meinen Ort stets in der Zukunft, bin auch jetzt voller Pläne und jage immer noch dem Bild aller Bilder hinterher.
Was reizte dich, nach der erfolgreichen Zeit als Rektor der Kunstakademie in Düsseldorf, das Epizentrum zeitgenössischer Kunst in Deutschland – wie manche behaupten - zu verlassen und für längere Zeit nach Berlin zu gehen?
Ich war immer in Berlin präsent und hatte dort auch ein Atelier. Berlin hat gewisse Ankerpunkte. Michael Werner, mit dem ich seit vielen Jahrzehnten zusammenarbeite, hat dort seine Galerie. Und nicht zuletzt leben viele Freunde dort. Beim Fall der Mauer machte sich die Muse auf und davon und kehrte der Stadt den Rücken. Berlin selbst gefällt sich darin, anderen Großstädten zu gleichen. Man hechelt einer gelangweilten und Amüsement süchtigen Klientel hinterher und verliert darüber völlig die eigene Identität und Individualität aus den Augen. Ein Zeitphänomen.
Es hieß: Berlin sei nach der Wende auf dem Weg, sich als Kunsthauptstadt Europas zu mausern. Hat sich das bewahrheitet oder war es ein „Kunstfehler“?
Was heißt hier „Kunstfehler“? Ich höre da einen leicht ironischen Unterton heraus. Nach der Wende haben sich viele Galerien gerade aus dem Rheinland für einen Umzug in die neue Hauptstadt entschlossen, weil man sich frischen Wind von der allgemeinen Aufbruchsstimmung versprach. Das hat sich jedoch alles wieder schnell abgekühlt, inzwischen gibt es gar Rückkehrer. Berlin fehlte und fehlt es an Sammlern und was noch mehr ins Gewicht fällt, an Hinterland. Nach der Wiedervereinigung spekulierte man auf eine Öffnung Richtung Osten. Die blieb aus. Ökonomisch unbedeutend, für die Kunst wurde es schwierig zu überleben.
Inzwischen bist du temporär wieder zurückgekehrt nach Mönchengladbach-Rheydt, die Stadt deiner Jugend. Was gab den Ausschlag für diese Entscheidung? Zurück aus Sentimentalität zu den Wurzeln deiner künstlerischen Prägephase?
Es verhält sich ganz simpel: Ich habe ein Haus in Rheydt. Als das Hinterhaus frei wurde, bin ich von Düsseldorf in mein eigenes Refugium gezogen. So einfach ist das und weit entfernt von sentimentalen Anwandlungen. Mönchengladbach hat viel an Charme eingebüßt. Städtebauliche Sünden soweit das Auge reicht. Und doch fühle ich mich, wenn ich dort weile, ganz wohl. Denn in der Regel geschieht das nur, wenn ich an Skulpturen in der Gießerei Schmäke, auf deren Gelände ich ein eigenes Atelier habe, in Düsseldorf arbeite.
Was bedeutet dir der Begriff „Heimat“ in dem Zusammenhang?
Sprache ist für mich Heimat. Die Sprache öffnet der Poe-sie die Welt, hier entstehen Welten; Welten, die man entwirft, um in sie einzutauchen und darin zu leben und sein Schaffen zu situieren. Es gilt, Atmosphären zu entwerfen. Auch ich in Arkadien! Jedoch ein Arkadien, das ich aufrufe, das ich in die Welt setze. Das habe ich in meinem Arkadienbuch versucht. Ich schaffe mir mit und in der Sprache Aufenthaltsräume, in denen meine Werke entstehen und in denen sie zur Geltung kommen.
Du bist Maler und Bildhauer, schreibst Gedichte und machst Musik. Viele deiner Künstlerkollegen besitzen vielseitige Eigenschaften. Wie geht man mit einer „Multi-begabung“ um? Läuft man nicht Gefahr, sich zu verzetteln?
Ich bin keine „Multibegabung“. Ich bin ein Maler. Und alle Aktivitäten außerhalb der Malerei erklären sich bei mir aus der Malerei. Um sie kreist mein Leben. Die Ausstellung, die dieses Frühjahr im Heinrich-Heine-Institut gezeigt wurde, verdeutlichte das nachdrücklich. Gezeigt wurden Lithographien von mir, die sich mit den sogenannten „Ignudi“ den „Nackten“, die Michelangelo unter die Decke der Sixtina setzte, beschäftigen. Ein Zwiegespräch, das ich, der Malerbildhauer, über die Jahrhunderte hinweg mit dem Bildhauermaler Michelangelo führe.
Deine Kunst wird gelegentlich als provokant bezeichnet. „Provokation muss mit Provokation beantwortet werden“, meinte ein selbsternannter Kritiker zur Mozart-Skulptur in Salzburg, um sie über Nacht zu Teeren und zu Federn. Steckt in deiner Kunst nicht manchmal auch die Absicht zu provozieren? Steckt vielleicht auch ein Stück Heinrich Heine in dir, wie die erfolgreiche Ausstellung im Heinrich-Heine-Institut in Düsseldorf zeigte?
Nein, ich strebe keine Provokation an. Das ist unter meinem Niveau. Ich gebe nur mein Bestes und suche die Vollendung. Wenn dieser Weg als provokant empfunden wird, dann ist das ein Problem des Betrachters und nicht mein Problem. Was Heine betrifft: Sein Widerspruchsgeist liegt mir nahe. Ebenso seine Idee vom Kunstgenie, dem er die Fähigkeit zuspricht, seinem Schaffen eigene Regeln zu geben. Das spricht mir aus der Seele. Vor einigen Jahren habe ich zusammen mit Heinrich Heil einen Gesprächs-band herausgebracht mit dem Titel „Der Kunst die Regeln geben“. Was wir dort im Gespräch entwickeln, bewegt sich erstaunlich nahe an der Skizze, die Heine in seinen Besprechungen der Pariser Kunstsalons vom Künstlergenie zeichnet.
Die Beschreibung deiner Person von einigen Kritikern und Kollegen als Künstler reichen von „Selbstdarsteller“, „Modestenz“, „Dandy“ bis „Genie“, um nur einige zu nennen. Dein Outfit in der Öffentlichkeit ist von ausgesuchter Perfektion. Treffen solche Etikettierungen zu oder verletzen sie Dich?
Es ist doch erstaunlich, dass sich die Öffentlichkeit darüber mokiert, auf einen gut gekleideten älteren Herrn zu treffen. Für mich ist das eine Selbstverständlichkeit. Da ich bei meiner Arbeit in Farbe und Gips wühle, habe ich anschließend das Bedürfnis, mich anständig zu kleiden und aufzutreten.
Eitelkeit wird von dir als Tugend und nicht als Beleidigung empfunden. Eitel zu sein, setzt eine gewisse Disziplin voraus und zieht eine ständige Reflektion nach sich, die danach fragt: „Wer bin ich? Und was will ich?“
Etwas auf sich halten, bedeutet aufmerksam zu sein und bewusst mit seiner Erscheinung umzugehen. Ich empfinde es als Zumutung, in welcher Nachlässigkeit viele herumlaufen. Dicke Bäuche, Farbkombinationen ohne Gefühl, Sinn und Verstand, ausgebeulte Jogging-Hosen und Jacken - ein Grauen, eine Unverschämtheit ohne Ende.
Die Motivation, ein bestimmtes Kunstprodukt besitzen zu wollen, kann auf reiner Spekulation beruhen oder auch auf der weitgehend geistigen Identifikation mit dem Künstler. Lässt einen lebenden Künstler so etwas kalt oder möchte er doch gerne wissen, wer seine Kreation kauft?
Wenn ein Gemälde oder eine Skulptur das Atelier verlässt, und ich mich davon trenne, habe ich damit abgeschlossen. Die Spekulationen des Marktes und der Sammler interessieren mich nicht. Allerdings ist es aufregend, dem eigenen Schaffen – etwa bei einer retrospektiven Ausstellung – wieder zu begegnen. Dann nehme ich sofort das Gespräch auf, und ich fühle mich heimatlich, denn ich bewege mich auf der eigenen Spur.
Wann werden wir eine Retrospektive deiner Arbeiten in unserer Region sehen können?
Demnächst. Aber entschuldige, dass ich bei laufenden Verhandlungen aktuell keine genaueren Angaben machen kann und will.
Kurzvita


„Wir Jonges arbeiten konstruktiv, aber auch kritisch, mit den Spitzen der Stadt und der Region zusammen“
Interview mit Wolfgang Rolshoven, Baas des Heimatvereins Düsseldorfer Jonges e.V.
von Dr. Siegmar Rothstein
Sie wurden im November 2012 zum Präsidenten – genannt Baas – der Düsseldorfer Jonges gewählt in einer für den Verein schweren Zeit, nachdem Ihr Vorgänger und der gesamte Vorstand wegen interner Meinungsverschiedenheiten zurückgetreten waren. „Versöhnen statt spalten“ lautet Ihr Motto. Waren und sind Sie erfolgreich, den Verein wieder in die gewohnt harmonische Spur zu bringen?
Wir sind mit dem Wahlspruch angetreten: Mehr wir, weniger ich. Als komplett neues 7-köpfiges Vorstandsteam sind wir gewählt worden und wurden ins kalte Wasser geworfen. Unser erstes Ziel war, die 51 Tischgemeinschaften wieder zu vereinen. Dies ist uns gelungen. Es herrscht wieder Einigkeit und Harmonie im Verein, wobei kontroverse, konstruktive Diskussionen erwünscht sind. Wir haben inzwischen auch die kaufmännische und technische Verwaltung reorganisiert und ein digitales Dokumentmanagement geschaffen, so wird zur Zeit vorrangig das Archiv digitalisiert. Außerdem haben wir eine hervorragende IT-Gruppe und sind im Jonges-Haus technisch bestens ausgestattet. Unser zweites Ziel war, unser Erscheinungsbild in der Öffentlichkeit zu verbessern, welches durch die Vorstandskrise sehr gelitten hatte. Wir haben ein professionelles Redaktionsteam gegründet und mit unserem Magazin „Das Tor“, einer neuen Homepage, Blogs, einem Newsletter sowie Aktivitäten in den sozialen Netzwerken Instrumente für eine wirksame Öffentlichkeitsarbeit geschaffen.
Dem früheren Bundespräsidenten Walter Scheel wird das Wort zugeschrieben: „An den Düsseldorfer Jonges kommt keiner vorbei“. Dem Verein wird damit ein sehr hoher Stellenwert zuerkannt. Wird die Stimme des Vereins auch bei maßgebenden Personen in Stadt und Land gehört und beachtet?
Wir sind uns der großen Verantwortung bewusst und arbeiten konstruktiv aber auch kritisch mit den Spitzen der Stadt und der Region zusammen. Wenn etwas nach unserer Auffassung in der Stadt aus dem Ruder läuft, erheben wir unsere Stimme. Beispielhaft erwähne ich den Streit um unsere Gaslaternen, um die uns viele Städte beneiden. Wir kämpfen zusammen mit vielen Initiativen für den Erhalt und damit gegen den von der Stadtverwaltung geplanten Austausch gegen LED-Lampen. Inzwischen sind wir optimistisch, dass viele der 14.000 Gaslaternen erhalten bleiben.
Unsere Vorgänger im Vorstand hatten sich mit Erfolg dafür eingesetzt, dass das Ständehaus nicht umgebaut und der Landtag am Rhein neu gebaut wurde. Wir waren auch gewissermaßen die ersten „Grünen“ in den 50er- und 60er-Jahren, als wir uns gegen die Zerstückelung unseres Hofgartens und der Landskrone gewehrt haben. Damals haben wir einen Protestmarsch - heute würde man sagen eine Demo - organisiert, an der 10.000 Bürgerinnen und Bürger sowie andere Heimatvereine beteiligt waren. Der Hofgarten wurde im vollen Umfange erhalten und unter Denkmal- und Naturschutz gestellt.
Werden die Jonges auch sonst nur positiv beurteilt oder werden sie auch gelegentlich kritisch gesehen?
Natürlich werden wir auch kritisiert. Konstruktive Kritik ist uns sehr wichtig, denn hieraus lässt sich viel Gutes gestalten und aufbauen. Wenn man in der Öffentlichkeit steht, bleibt die Kritik nicht aus, das sollte man aushalten können, sonst ist man fehl am Platz. Wenn man etwas bewegen möchte, kann man nicht immer der Freund aller sein.
Was sind jetzt die wichtigsten Anliegen, wie werden die Jonges aktiv?
Stadtbild- und Denkmalpflege stehen an erster Stelle. Ich nenne einige Beispiele:
2012 sah der Bebauungsplan am Kö-Bogen vor, dass der Gustav-Gründgens-Platz zugebaut werden sollte. Wir haben 2013 den Anstoß gegeben, dass eine Sichtachse zum Schauspielhaus bestehen bleiben muss. So ist der Kö-Bogen 2 entstanden.
Wir haben in den letzten 87 Jahren der Stadt über 85 Denkmäler, Skulpturen und Gedenktafeln geschenkt, wobei unsere Tischgemeinschaften auch die Patenschaften zur Pflege übernommen haben. Das letzte große mit dem Namen der Jonges verbundene Denkmal war 2017 das der Mutter Ey auf dem Mutter Ey-Platz an der Mühlenstraße. In der Planung ist ein Köbes-Denkmal auf dem Bolker Stern sowie Gedenktafeln für Dr. Mooren, den berühmten Augenarzt, sowie für die Komponisten Carl Hütten und Karl Robert Kreiten. Wir setzen uns auch dafür ein, dass vier Plätze in Düsseldorf nach den Düsseldorfer Jonges, dem Hoppeditz, Fortuna Düsseldorf und Borussia Düsseldorf benannt werden. Stolz sind wir auch auf unser Projekt „Sturm Ela“, denn wir haben 160 neue Bäume gepflanzt. Darüber hinaus verfolgen wir soziale Projekte. Gemeinsam mit anderen Partnern kümmern wir uns um Kinder im Alter von 12-17 Jahren, die ohne Begleitung zu uns gekommen sind. Ihnen wurde ein professionelles Training im Fußball und Tischtennis ermöglicht. Sie werden eingekleidet, verpflegt, lernen Disziplin, Fairplay und vor allem die deutsche Sprache. Wir unterstützen jedes Jahr mit einem Betrag von 25.000 Euro zehn gemeinnützige Organisationen, wobei wir im Einzelnen verfolgen, was mit dem Geld geschieht.
Weiterhin werden von uns regelmäßig Förderpreise für Musik, Wissenschaft und Architektur, neuerdings auch im Handwerk, verliehen.
Die Düsseldorfer Jonges sehen sich als größter und aktivster Heimatverein Europas mit nahezu 3.000 Mitgliedern. Fast alle Berufe sind in der Mitgliederliste zu finden. Der Verein hat offenbar eine große Anziehungskraft. Worauf ist dies zurück zu führen?
Über 288 Berufe sind bei uns vertreten: Arbeiter, Geschäftsführer, Handwerker, Wissenschaftler, Künstler, Freiberufler und Politiker. Wir sind ein repräsentativer Querschnitt der männlichen Bevölkerung in dieser Region und haben inzwischen mehr als 3.000 Mitglieder. Man muss aber nicht in Düsseldorf geboren sein, um Heimatfreund zu werden. Unser Ziel war es, Menschen aus allen Ländern und Religionsgemeinschaften, die einen Bezug zu unserer Heimatstadt haben, zu integrieren. Dies ist uns gelungen. Jeder, der unsere Ziele anerkennt und sich auf dem Boden des Grundgesetzes bewegt, ist bei uns willkommen. Diese Einstellung und Zielsetzung motiviert, bei uns Mitglied zu werden - mal ganz abgesehen davon, dass man bei uns Freunde finden kann.
Führt die Mitgliedschaft auch zu wirtschaftlichen Kontakten?
Das Ziel, durch den Beitritt zu den Düsseldorfer Jonges wirtschaftliche Kontakte zu bekommen, steht nicht im Vordergrund, wenn wir uns natürlich auch wechselseitig helfen und lieber einen Heimatfreund beauftragen, bevor wir jemanden in den Gelben Seiten suchen.
Vereine beklagen oft, dass ihnen der Nachwuchs fehlt. Das gilt insbesondere für Jüngere. Die Düsseldorfer Jonges haben in den letzten Jahren steigende Mitgliederzahlen erzielt. Womit überzeugen Sie gerade die Jüngeren, Mitglied zu werden?
Unser jüngstes Mitglied ist 16 Jahre alt und unser ältestes Mitglied 101 Jahre. Das hat natürlich Einfluss auf unsere Programmgestaltung. Wir haben unsere Heimatabende (jeden Dienstag in der Altstadt mit 500 Jonges im Schnitt) verjüngt. Jung ist natürlich relativ. Das Durchschnittsalter bei den neuen Mitgliedern liegt bei 49 Jahren.
Die Düsseldorfer Jonges sind eine reine Männergesellschaft. Sie nehmen keine Frauen auf. Wie begegnen Sie dem Vorwurf, dies sei nicht zeitgemäß oder gar altmodisch?
Es gibt neben gemischten Vereinen in Düsseldorf Vereine, die nur Männer aufnehmen, andererseits solche, die sich nur für Frauen öffnen (Weiter, Soroptimisten, Akademikerinnenvereine, Medici Kunst- und Kulturverein). Bemerkenswert ist, dass die Frauenvereine deswegen nicht kritisiert werden, sondern nur die Männervereine. Es gibt natürlich auch bei uns Veranstaltungen, bei denen Frauen anwesend sind. Es muss aber doch möglich sein und toleriert werden, dass sich Männer ebenso wie Frauen getrennt treffen und Kontakte pflegen.
Pflegen die Jonges auch Kontakte zu Bereichen außerhalb Düsseldorfs?
Wir pflegen Kontakte zu den Neusser Heimatfreunden, den Ratinger Jonges, dem Krefelder Heimatverein, den Derendorfer Jonges und vielen Stadtteilvereinen sowie zum Verein Pro Ruhrgebiet in Essen. Diese Kontakte führen zu einem sehr fruchtbaren Gedankenaustausch.
Sie haben als Baas ein anspruchsvolles und sicher auch zeitaufwändiges Ehrenamt. Wie darf man sich Ihre Tätigkeit vorstellen?
2018 war ich – wie wir kürzlich einmal aufgeschlüsselt haben – über 60 Stunden pro Woche tätig. Meist fahre ich gegen 9 Uhr ins Büro und bleibe bis 18 Uhr, nehme tagsüber Termine wahr und abends kommen Abendveranstaltungen dazu, bei denen der Verein präsent sein sollte. Ich führe viele Gespräche innerhalb der Stadt. Zur Zeit kämpfe ich gegen den wieder erstarkten Antisemitismus sowie für bezahlbaren Wohnraum in Düsseldorf. Dies sind Themen, die eskalieren können. Hier muss der Verein frühzeitig Stellung beziehen. Das macht viel Arbeit, bringt aber auch viel Freude, da etwas bewegt wird, sonst würde ich das Amt nicht ausüben. Zur Zeit versuche ich allerdings, den Sonntag ohne Verpflichtungen zu gestalten. Leider ist es mir noch nicht ganz gelungen, aber ich arbeite daran.
Kurzvita